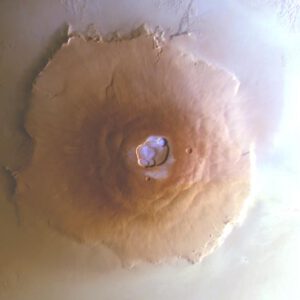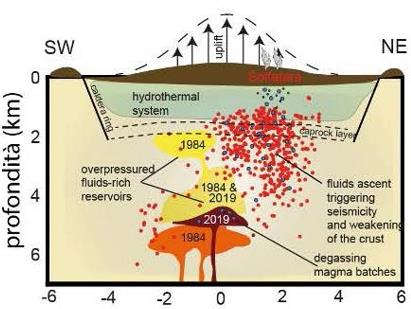In Norwegen wurde die größte Lagerstätte an Seltenen Erden in Europa entdeckt – Altes Vulkansystem ist der Ursprung
Norwegen hat im Fen-Karbonatitkomplex Europas größtes Vorkommen an Seltenen Erden entdeckt. Diese Gruppe chemisch ähnlicher Elemente ist für viele Hightech-Anwendungen und grüne Technologien unverzichtbar. Bisher dominierte China den Markt, doch Norwegens Fund könnte diese Abhängigkeit verringern.
Der Fen-Karbonatitkomplex liegt 108 km südwestlich von Oslo und wurde nach dreijährigen Explorationen als Europas größte Lagerstätte für Seltene Erden identifiziert. Im Gegensatz zu anderen Fundorten liegen hier die Elemente in wirtschaftlich abbaubaren Konzentrationen vor, was eine rentable Förderung ermöglicht. Besonders wertvoll sind hier Elemente wie Neodym und Praseodym, die in Magneten verwendet werden. Sie sind wichtige Rohstoffe für die Herstellung von Elektromotoren, Windturbinen und Smartphones.
 Was die Entdeckung im Kontext von Vnet besonders interessant macht, ist der Umstand, dass es sich beim Fen-Karbonatitkomplex um eine Lagerstätte magmatischen Ursprungs handelt. Das Gebiet liegt im Bereich des divergenten Oslograbens, wo es während des Erdzeitalters Perm vor gut 60 Millionen Jahren aktiven Vulkanismus gab. Die Bildung der Gesteine der Lagerstätte reicht aber noch viel weiter in die Erdgeschichte zurück: Die Gesteine der Lagerstätte bildeten sich bereits vor gut 580 Millionen Jahren, in einem vulkanischem Fördersystem, in dem karbonatische Schmelze erstarrte. Das Vulkangebiet erodierte im Laufe der Jahrmillionen und heute liegt das Fördersystem mit einem Durchmesser von 2 Kilometern nahe der Oberfläche. Der Schnitt erinnert mich ein wenig an eine Kimberlit-Pipe, und das karbonatische Gestein am Oslograben ein wenig an den Ol Doinyo Lengai im ostafrikanischen Riftvalley. Hoffentlich kommt man nicht auf die Idee, diesen Vulkan abzubaggern.
Was die Entdeckung im Kontext von Vnet besonders interessant macht, ist der Umstand, dass es sich beim Fen-Karbonatitkomplex um eine Lagerstätte magmatischen Ursprungs handelt. Das Gebiet liegt im Bereich des divergenten Oslograbens, wo es während des Erdzeitalters Perm vor gut 60 Millionen Jahren aktiven Vulkanismus gab. Die Bildung der Gesteine der Lagerstätte reicht aber noch viel weiter in die Erdgeschichte zurück: Die Gesteine der Lagerstätte bildeten sich bereits vor gut 580 Millionen Jahren, in einem vulkanischem Fördersystem, in dem karbonatische Schmelze erstarrte. Das Vulkangebiet erodierte im Laufe der Jahrmillionen und heute liegt das Fördersystem mit einem Durchmesser von 2 Kilometern nahe der Oberfläche. Der Schnitt erinnert mich ein wenig an eine Kimberlit-Pipe, und das karbonatische Gestein am Oslograben ein wenig an den Ol Doinyo Lengai im ostafrikanischen Riftvalley. Hoffentlich kommt man nicht auf die Idee, diesen Vulkan abzubaggern.
Die Beschaffung von Seltenen Erden ist oft teuer und unsicher. Rare Earths Norway (REN), das die Abbaurechte besitzt, plant eine nachhaltige Gewinnung und arbeitet dabei mit der Montanuniversität Leoben zusammen. Ziel ist es, die ökologischen Auswirkungen von der Mine bis zum Endprodukt zu minimieren.
Der Fund ist bedeutend, da Europa derzeit fast vollständig auf Importe angewiesen ist, vor allem aus China, das etwa 70 % der globalen Förderung und 90 % der Verarbeitung kontrolliert. Norwegen könnte durch diesen Fund zum wichtigen Akteur auf dem globalen Markt werden und Europas Versorgungssicherheit erhöhen. Dies ist besonders wichtig für Technologien wie erneuerbare Energien und Elektroautos.
Insgesamt hat der Fen-Karbonatitkomplex das Potenzial, sowohl die europäische als auch die globale Versorgung mit Seltenen Erden sicherer und nachhaltiger zu gestalten.