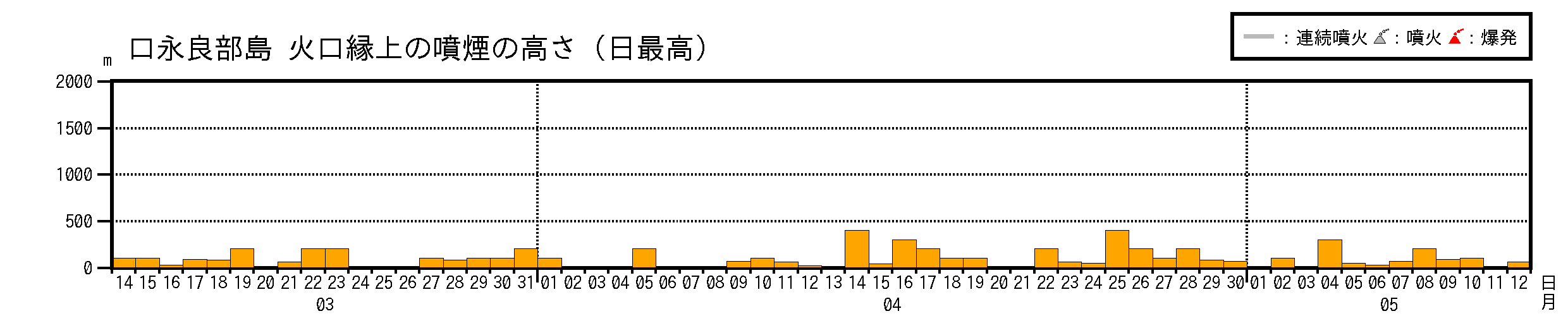Am Vulkan Reventador in Ecuador scheint die Stärke der explosiven Eruptionen zuzunehmen. IGEPN berichtet von Eruptionswolken die 600 m hoch aufsteigen. Glühende Tephra wird weit ausgeworfen und bedeckt die oberen Bereiche des Kegels. Die Seismik ist hoch. Am 18. März wurden in 24 Stunden 31 langperiodische Erdbeben registriert, sowie 4 Episoden mit harmonischen Tremor. 25 seismische Signale stammten von Explosionen.
Anak Krakatau emittiert Wärmestrahlung
In Indonesien nähert sich die Regenzeit ihrem Ende und die Thermal-Satelliten empfangen wieder regelmäßigere Wärmesignale. So auch von Anak Krakatau. MIROVA registriert eine moderate Wärmestrahlung von 13 MW. Da keine Berichte über strombolianische Eruptionen vorliegen, scheint die Wärmestrahlung von einem offenen Förderschlot auszugehen in dem Magma steht. Es könnte also jeder Zeit zu Eruptionen kommen. In den letzten Jahren war Anak Krakatau ungewöhnlich ruhig.
Ätna mit Aschepuffs
Der Vulkan auf Sizilien lässt uns weiterhin auf eine große Eruption warten. Die Anzeichen, dass der Ätna zu einer Eruption bereit ist, mehren sich in den letzten Monaten: Inflation und Seismik sind hoch und der NSEC entlässt gelegentlich kleine Aschepuffs. So auch in den letzten Tagen. Gestern ereigneten sich 2 Erdbeben mit den Magnituden 3,1 und 2,4. Auf Luftaufnahmen vom 18. März sieht man eine kleine Ascheeruption.
Kirishima wieder aktiv
Nachdem das VAAC Tokyo 4 Tage lang keine Eruptionen des japanischen Vulkans mehr registriert hatte, meldete sich der Kirishima gestern mit 3 Explosionen zurück. Vulkanasche stieg bis in einer Höhe von 4 km auf. Insgesamt ist die Aktivität rückläufig.
 Steamboat Geyser im Yellowstone eruptierte
Steamboat Geyser im Yellowstone eruptierte
Der weltgrößte Geysir Steamboat eruptierte am 15. März im Yellowstone Nationalpark. Die Eruption fand am Spätnachmittag statt. Scheinbar gibt es keine Augenzeugen (das Bild stammt aus dem Jahr 2005) des Ereignisses. Die Eruption wurde über das seismische Netzwerk detektiert. Zudem ist der Hitzefluss im Untergrund deutlich erhöht. Schlamm und Gesteinsbrocken wurden bis in umliegende Wälder geschleudert. Eine Straße in der Nähe wurde vorsichtshalber gesperrt.
Steamboat Geyser liegt im hinteren Teil des Norris Geyser Basin, welcher seit einigen Jahren gesperrt ist. Grund für die Sperrung ist ein Temperaturanstieg der Gas- und Wassertemperaturen, sowie eine Bodendeformation. Der Geysir springt spontan und Vorhersagen sind nicht möglich. Zuletzt eruptierte er im September 2014. Seitdem der Temperaturanstieg statt fand sprang der Steamboat-Geyser öfters, als in den Jahren zuvor.